Diese Zusammenkunft von Expert:innen befasst sich mit dem Drehtüreffekt der Gefängnisstrafe drogenkranker Frauen in Österreich. Erläutert, diskutiert und erweitert wurden die Diagramme zu den Straftaten 1 + 2, in denen begangene Straftaten den erlittenen Straftaten der parrhesia Teilnehmerinnen aus der Therapieeinrichtung Schweizer Haus Hadersdorf (Wien, 2022) und der Justizanstalt Schwarzau (Schwarzau am Steinfeld, 2023) gegenübergestellt werden. Einsichten aus Forschungsprojekten der Expert:innen in Österreichischen Gefängnissen werden besprochen, und mit Erfahrungen und Befunden aus den parrhesia Projektausführungen in Österreich verglichen. Es werden Aspekte der Verfügbarkeit von Beratung, Unterstützung und Substitution nach der Haftentlassung erörtert.

AUFTAKT
Das erste Kompliz:innentreffen zu Ulrike Möntmanns neuem Arts-based Research-Projekt PARRHESIA – Die riskante Handlung des Wahrsprechens fand nach zwei intensiven Arbeitsphasen in den österreichischen Frauenjustizvollzugsanstalten Schwarzau und Schweizer Haus Hadersdorf Wien im März 2023 im Depot Wien statt. Das projektinterne Gesprächsformat, in dem Expertisen aus Theorie und Praxis verschiedener Arbeitsbereiche und Forschungsdisziplinen zusammengebracht werden, hat sich im Vorgängerprojekt THIS BABY DOLL WILL BE A JUNKIE (TBDWBAJ, 2004–2019) bewährt und ist inzwischen fester Bestandteil von Ulrike Möntmanns künstlerisch-wissenschaftlicher Forschung. Komplementär zu den regelmäßigen öffentlich stattfindenden Expert Meetings begleitet es die einzelnen Projektphasen mit kritischen Reflexionen aus unterschiedlichen Perspektiven. In einem rund dreistündigen Gespräch stellt Ulrike Möntmann gemeinsam mit ihren Mitarbeiter:innen Stefanie Elias und Stefan Auberg, die bisherigen Ergebnisse vor und diskutiert diese mit den ›Komplizinnen‹ Veronika Hofinger, Barbara Kraml, Johanna Meyer und Monika Stempowski aus psychologischen, juristischen und sozialwissenschaftlichen Blickwinkeln.
Die folgende Zusammenfassung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern beschränkt sich auf die fragmentarische Wiedergabe der diskutierten Themen, die für die weitere Entwicklung des Projekts von Bedeutung sind.
Zu Beginn des Gesprächs umreißt Ulrike Möntmann knapp den Status quo: Ihr neues Projekt befasst sich erneut mit drogensüchtigen Frauen in europäischen Gefängnissen. Während TBDWBAJ sich auf West- und Osteuropa konzentrierte, sollen die einzelnen PARRHESIA-Projekte auf der Nord-Süd-Achse stattfinden, was jedoch neben der ohnehin oftmals geringen Kooperationsbereitschaft der Institutionen durch die Corona-Pandemie erheblich erschwert wurde.
Der Titel und damit das zentrale Anliegen geht auf Michel Foucaults Auseinandersetzung mit der griechischen Gesellschaft der Antike zurück. ›Parrhesia‹ meint den Mut zur Wahrheit unter riskanten Bedingungen, denn das freimütige, kritische öffentliche Wahrsprechen eines Individuums, dessen soziale Position unterhalb derer der Machthabenden angesiedelt ist, kann unabsehbare Folgen haben. Und genau darum geht es: Im Rahmen einer solchen parrhesiastischen Speech Activity, wie Foucault es nannte, formulieren die am Projekt beteiligten Frauen ihre zuvor gemeinsam mit Möntmann und ihrem Team erarbeiteten Biografien. Zweiter Schwerpunkt des Projekts ist das Erstellen von Diagrammen, bestehend aus den von den Frauen begangenen Straftaten (I) in Gegenüberstellung mit denen an ihnen verübten Straftaten (II). Als Künstlerin und Wissenschaftlerin mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung in Gefängnisprojekten ist Ulrike Möntmann gespannt, wie die eingeladenen Komplizinnen das Einfließen von Kunstelementen in die Forschung bewerten.
Veronika Hofinger vom Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie der Universität Innsbruck befasst sich schon länger mit dem (Frauen-)Strafvollzug und hat im Rahmen ihrer Studien zur Gewalt in Haft ebenfalls Interviews mit Inhaftierten, darunter auch in der JA Schwarzau, geführt. Ihr aktuelles Projekt befasst sich mit der Digitalisierung in Gefängnissen, dem stark beschränkten Zugang zur Außenwelt via Internet, insbesondere für Frauen. Was sie an Möntmanns Projekt besonders fasziniert, ist die gelungene Ermutigung zur parrhesiastischen Speech Activity: Esma Bronkovič, eine der Projektteilnehmerinnen, um die es im Folgenden noch häufiger gehen wird, schrieb im Rahmen des Projekts großartige, eindrucksvolle Raps über ihr Leben, während sie im Gespräch mit dem Forschungsteam um Veronika Hofinger, wie diese berichtet, kaum ein Wort von sich gab.
Johanna Meier hat im Rahmen ihres Lehramtsstudiums Psychologie studiert und später Schauspiel; sie hat Erfahrungen in der Suchthilfe und arbeitet aktuell im Jugendcoaching, einem österreichweiten Projekt, das »Ausbildungsberatung von ausgrenzungsgefährdeten Jugendlichen am Ende ihrer Schulpflicht« anbietet. Es geht also um eine großräumige Unterstützung und Vermittlungsarbeit im Rahmen eines breit gefächerten Kooperationsnetzwerks.
Monika Stempowski hat langjährige Erfahrung im Bereich der Abhängigkeitserkrankungen und befasst sich überdies seit inzwischen zehn Jahren mit empirischer Forschung an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, schwerpunktmäßig mit dem Straf- und Maßnahmenvollzug für psychisch kranke Personen. Die studierte Psychologin und Juristin hat ebenfalls zunächst in der Suchthilfe gearbeitet, danach ihre Ausbildung im Schweizer Haus Hadersdorf gemacht sowie im Universitätsklinikum Wien (AKH) schwangere drogenabhängige Frauen betreut.

I. Sprachbarrieren
Monika Stempowski interessiert sich vor allem für den Aspekt der Sprache als Instrument und Technik der Verständigung, der auch für das PARRHESIA-Projekt von besonderer Bedeutung ist. Doch eine solche Verständigung, etwa über eine Urteilsbegründung, sei, wie sie weiterhin ausführt, nicht nur zwischen Justiz und der angeklagten bzw. verurteilten Person schwierig, sondern schon zwischen Jurist:innen und Psycholog:innen kaum zu erreichen, selbst wenn diese über den gleichen Sachverhalt sprechen. Denn »es werden Begriffe verwendet, vielleicht sind es dieselben Begriffe, aber mit anderem Bedeutungsgehalt; vielleicht sind es unterschiedliche Begriffe, die aber eigentlich dasselbe meinen; dann gibt es juristische Begriffe, die ein psychologisches Phänomen beschreiben sollen, wo ich mir dann auch als Psychologin denke: ›ich weiß nicht so genau, was das eigentlich heißt, also in unseren Termini macht das keinen Sinn‹.« Neben der Terminologie seien es auch die inneren Logiken der verschiedenen Felder, die sich nur schwer übersetzen ließen. »Insofern finde ich diesen Sprachaspekt«, so Stempowski mit Blick auf das PARRHESIA-Projekt, »noch einmal von einer ganz anderen Seite beleuchtet, nämlich der künstlerischen Seite, sehr, sehr interessant.«
Ulrike Möntmann bestätigt diese Diagnose aus ihrer Erfahrung heraus: In den Expert Meetings zum vorherigen Projekt stellte sie fest, dass zwar gegenseitig großes Interesse an den jeweiligen fachlichen Expertisen bestand, sich durch die fehlende gemeinsame Sprache aber häufig keinerlei wirkliche Erkenntnisse entwickeln ließen, vielmehr eine gewissermaßen »touristische« Neugier regierte. Daher habe sie die Kompliz:innentreffen in den begleitenden Reflexionsprozess eingeführt, »um dieses Wissen in die Welt zu kriegen«, wie sie im Anschluss an das Kernanliegen der »Wissenszirkulation« ihrer OUTCAST REGISTRATION betont.
Die Schwierigkeiten des Projekts begannen jedoch weit früher, wie Stefan Auberg nun berichtet. Eine bereits 182 Seiten umfassende Dokumentation ihrer Bemühungen, mit geeigneten Haftanstalten in Nord- und Südeuropa in Kontakt zu treten, ist daher auch eine Chronik des Scheiterns: Die Bereitschaft sei gering, häufig sei ihnen »einfach die Tür vor der Nase zugschlagen« worden, was sie schließlich zu einer Strategieänderung bewegt habe. Über institutionsunabhängige Wissenschaftler:innen in den jeweiligen Ländern, die sich im weitesten Sinne mit dem Thema Haft befassen, wurden neue Kontakte geknüpft, die inzwischen Anlass zu Hoffnung auf Projekte in Finnland und Tschechien machten. Hingegen sei die Bereitschaft in Österreich, zumindest in manchen Institutionen, relativ groß, wie Veronika Hofinger und Ulrike Möntmann einhellig festhalten. Insgesamt sei aber zu beobachten, dass gerade sogenannte internationale »Vorzeigeanstalten«, die etwa in den Bereichen Frauenvollzug und Digitalisierung besonders progressiv sind und dies auch nach außen tragen, kaum zugänglich seien, da sie schlichtweg mit Anfragen überhäuft würden.
II. Ausbildungswege
Eine solche Vorzeigeanstalt befindet sich beispielsweise in Norwegen, die sich vor allem für Ausbildungsmöglichkeiten der Häftlinge engagiert, ein Aspekt, der auch Ulrike Möntmann beschäftigt. Ihrer Erfahrung nach seien diese in der Regel »furchtbar deprimierend«: von Käse einschweißen über Deckel für Motorölbehälter sortieren bis hin zum Verschrauben von Stuhlbeinen für ein großes schwedisches Einrichtungshaus. Keine geeignete zukunftsfähige Ausbildung anzubieten, erscheint Ulrike Möntmann wie eine zwar unausgesprochene, aber zugleich auch besonders wirksame zusätzliche Strafe. Johanna Meyer sieht darin eine Parallele zur freien Gesellschaft, denn auch im Gefängnis erhielten nur diejenigen Förderung für arbeitsmarktpolitisch gefragte Lehrberufe, die ohnehin schon privilegiert sind – allen anderen gelinge dies allenfalls unter enormen Anstrengungen, meistens jedoch gar nicht. Ulrike Möntmann ergänzt, dass sie häufig lediglich »Hilfsfunktionen« ansteuerten: »man wird dann Küchenhilfe von der Küchenhilfe«. Ursächlich dafür ist laut Monika Stempowski wiederum das weitläufige Sprachproblem, etwa zwischen Insass: innen und Gefängnispersonal; dabei geht es hier zunächst weniger um eine spezifische Terminologie als um eine grundsätzlich gemeinsame Sprache. Hinzu kommen massive Personalprobleme: Justizbeamt:innen haben sich zuallererst mit Sicherheitsfragen zu befassen, die schon kaum zu bewältigen seien; zusätzliche Aktivitäten, wie etwa Häftlinge in Werkstätten zu Ausbildungszwecken zu beaufsichtigen, sei da zumeist gar nicht möglich. »Das heißt, das Erste, was wegfällt, ist die Tagesbeschäftigung, ist die Arbeit in Haft.« Und Jugendliche hätten im Rahmen ihrer inzwischen oft kurzen Haftdauer keine Chance, eine begonnene Ausbildung abzuschließen – »ein paradoxes Ergebnis« der Bemühungen, Haftstrafen zu verkürzen und stattdessen andere Maßnahmen zu ergreifen. Nur, wie geht es draußen weiter? Wie kann die notwendige »Transformation« gelingen? Zwar gebe es erste Bemühungen, die aber insgesamt noch lange nicht ausreichten.
Aus den Gesprächen mit den inhaftierten Frauen ist bei Stefanie Elias der Eindruck entstanden, dass vor allem die jüngeren unter ihnen mit durchaus längeren Haftstrafen über ihre Ausbildungsmöglichkeiten und Beschäftigungsangebote gar nicht ausreichend informiert seien. Veronika Hofingers Erfahrung nach werde hingegen mehr in die Förderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Gefängnis investiert als in Angebote für ältere Häftlinge. »Mir hat eine Insassin, die total begierig war, was zu lernen […], gesagt, sie hat sieben Monate auf einen Häkelkurs gewartet und dann hat sie ihn bekommen […], und dann durfte sie keinen anderen Kurs mehr belegen«. Das wiederum hinge wohl auch mit dem Ausbildungsgesetz zusammen, das auch dem Gefängnis vorschreibt, bis zu einem gewissen Alter – aber eben nur bis dahin – Schul- und Berufsausbildungen anzubieten.
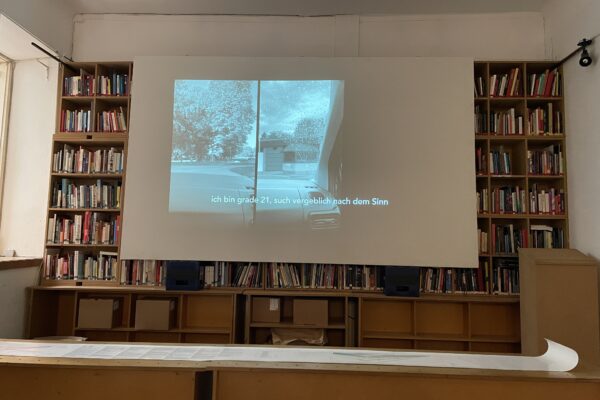
Einspielung RAP »MAMA HÖRT MICH VON HIER DRINNEN NICHT« von Esma Bronkovič
III. Diagramme auf dem Prüfstand
Ulrike Möntmann stellt nun das zweite Kernelement ihres Projekts vor: Die Straftaten-Diagramme, und zwar zum einen das von Rebecca Mertens aus TBDWBAJ und zum anderen die zwei der bislang erstellten Diagramme im Rahmen des PARRHESIA-Projekts. Visualisiert werden darin die Straftaten (I), die die beteiligten Frauen jeweils begangen haben und für die sie teilweise verurteilt wurden, in Gegenüberstellung mit den Straftaten (II), die zumeist seit frühester Kindheit an ihnen verübt und nur in seltenen Fällen geahndet wurden. Was Ulrike Möntmann hier interessiert, ist der juristische Blick auf die Verhältnismäßigkeit der Straftaten I und II, zumal es nicht nur auf ›menschlich-moralischer‹, sondern auch auf juristischer Seite Ungereimtheiten, Verfehlungen und Versäumnisse bis hin zu mutmaßlicher Gewaltanwendung gab, die zuallererst für die Frauen fatale Konsequenzen hatten und haben. Eine solch offene Kritik an eklatanten Schwachstellen in den Verfahrens- und Umgangsweisen, nicht zuletzt auch der beteiligten Institutionen, könnte allerdings künftige Kooperationen erneut erschweren, wie Stefan Auberg zu bedenken gibt. Sie deshalb zu verschweigen, weil sie ›nur‹ auf den Erzählungen der Frauen basieren, sei aber keinesfalls die Lösung, meint Veronika Hofinger, auch wenn sie selbst bereits die Erfahrung gemacht hat, dass den Aussagen der Häftlinge erschreckenderweise wenig Aufmerksamkeit zuteilwird. Pauschale Aburteilungen der Institutionen seien hier natürlich auch nicht fair und förderlich, vielmehr sei Exaktheit in der Benennung der Quelle das beste Mittel. Manchmal müsse aber auch der anonyme Weg über externe Stellen genommen werden, der dann die beste und sicherste Möglichkeit sei, sich mit einer Beschwerde Gehör zu verschaffen, ergänzt Johanna Meyer.
Monika Stempowski kommt in diesem Punkt noch einmal konkreter auf das Ziel des Projekts zu sprechen, das zu definieren sei: Werden geschehene Ereignisse dokumentiert oder geht es um Prävention? »Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Fragestellungen mit ganz unterschiedlichen Handlungsimpetus«, die selbst bei konfligierender Interessenlage der kooperierenden Personen und Institutionen klar benannt werden müssten und sowohl die Methodik als auch die Auswertung und das Bewusstsein über subjektive Darstellungen umfassen. Stichwort hier ist »Integrität der Arbeit«: »Es gibt Dinge, die müssen kritisiert werden, die muss man auch so benennen, aber nicht […] mit einer Einseitigkeit in die eine oder andere Richtung – nur zu sagen, alles, was die [Häftlinge] erzählen, kann ich eh vergessen […], das wäre eine Katastrophe. Und umgekehrt genauso zu sagen, das, was das System macht, ist […] in jedem Fall schädlich für die Betroffenen […]. Hier zu versuchen, die verschiedenen Spannungsfelder so aufzuzeigen, wie sie sind, und das mit der Exaktheit, ist so ein wichtiger Punkt.« Umso vorsichtiger sollte man Stempowskis Ansicht nach mit den Kontexten der berichteten Erlebnisse umgehen, »das eine ist der Kontext der Wahrnehmung und ihres Erlebens und das andere ist dann zum Beispiel eine juristische Bewertung«.
IV. Terminologische Fragen
Der Terminus »Grausamkeit« sei ein gutes Beispiel, führt Monika Stempowski weiter aus, der in juristischer Bewertung eines Delikts durchaus zu Anwendung kommen und zu einem höheren Strafmaß führen kann; in den vorliegenden Diagrammen sei er jedoch nicht in dieser Weise verwendet worden. »Prosa der Taten oder der Straftaten«, stellt Ulrike Möntmann dazu fest, »weil wir keine Juristinnen sind«. Trotz überaus sorgfältigem Umgang mit den gesammelten Daten sei ihr Ansatz: „Ich frage nach den Geschehnissen […], und ich gehe davon aus, dass mir die Wahrheit erzählt wird. Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln.« Stefanie Elias verweist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf, dass es sich bei den Diagrammen noch um vorläufige Versionen handelt, die sowohl Fragen zur technischen Datenverarbeitung als auch zur juristischen Interpretation aufwerfen.
Was die Frage nach der juristischen Einordnung angeht, gesteht Monika Stempowski rundheraus: »ich traue mich das nicht«, und zwar weil ihr im konkreten Fall sowohl die historische als auch die inhaltliche Kompetenz dafür fehle. »Wie ist dies) e Aussage einzuschätzen, glaubt man dieser Person? Und auf Basis dessen subsumiert das Gericht dann diesen Sachverhalt und einen bestimmten Tatbestand. Aber das ist sehr, sehr aufwendig und sehr komplexe juristische Arbeit, für die auch ganz viel Information vorhanden sein muss. Weit mehr Information als ›ich wurde geschlagen‹ oder ›ich habe blaue Flecken gehabt‹.«
Veronika Hofinger hingegen bezweifelt, dass das im Fall von Rebecca Mertens (wie auch bei Esma Bronkovič und vielen anderen Frauen) überhaupt erforderlich sei – für die Glaubwürdigkeit einer in unzähligen Fällen unterlassenen Hilfeleistung seitens der Mutter brauche man eigentlich keine Paragrafen. Und auch Ulrike Möntmann beharrt nochmal auf der unverkennbaren Unverhältnismäßigkeit der Haftstrafen für Rebecca Mertens und den systematischen sexuellen Misshandlungen, denen sie seit dem Säuglingsalter ausgesetzt war.
Zwar findet Monika Stempowski die Idee der Gegenüberstellung völlig einleuchtend, fragt sich aber weiterhin, ob das für die Darstellung des individuellen Schicksals einerseits hilfreich ist und andererseits Ulrike Möntmanns Vorhaben womöglich insofern in Gefahr bringt, als sie sich in puncto Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen angreifbar machen könnte und »dass dadurch das, worum es geht, nämlich das Erleben und diese Belastungen und Übergriffe und Aggressionen, die sie erfahren hat, dass das dann eigentlich wieder entwertet wird«. Im Folgenden werden weitere Ungenauigkeiten beim juristischen Vokabular der Diagramme kritisch unter die Lupe genommen, etwa der Unterschied zwischen Verwaltungs-, Geld- und Freiheitsstrafe sowie alternativen Maßnahmen (Diversionen oder Sanktionen). Insgesamt fördert die kritische Diskussion eine wichtige Erkenntnis zutage: Das juristisch penible Gegeneinander-Aufrechnen der Straftaten im Rahmen der Diagramme ist überhaupt nicht erforderlich, um das Systemversagen gegenüber den Frauen anschaulich zu machen.
Eine weitere Frage zur Visualisierung betrifft die grundsätzliche Aufnahme von Delikten der Frauen im strafunmündigen Alter, darunter beispielsweise der Diebstahl von Omas Zigaretten mit sieben Jahren, die zwar keine juristischen, womöglich aber gewalttätige erzieherische Konsequenzen im familiären Umfeld hatten. Die wichtigen Hinweise zur korrekten Terminologie und Zuordnung nimmt das Team um Ulrike Möntmann dankbar auf, um die korrespondierenden Ereignisse, die sich nach wie vor in einem krassen Ungleichgewicht befinden, noch eindeutiger und in korrekter Darstellung nachvollziehbar zu machen. Wie im Fall von Ivana Landmann mit einer »der schlimmsten Biografien«, die Ulrike Möntmann je aufgezeichnet hat, die inzwischen 38 Jahre alt ist und bereits 17,7 Jahre im Gefängnis sitzt – während die Täter, ihr leiblicher Vater und ihr Stiefvater, überhaupt nicht zur Rechenschaft gezogen wurden bzw. lediglich wenige Jahre bekommen haben. Nach seiner frühzeitigen (!) Entlassung hat der Stiefvater Ivana, die zum Tatzeitpunkt fünf Jahre alt war, wegen »Verführung« angezeigt.
Das alles führt wiederum zu der Frage, wie sich mehrere Taten, Urteile und Haftstrafen überhaupt zueinander verhalten, was Monika Stempowski unter Verweis auf international unterschiedlich ausgerichtete Rechtssysteme für Österreich folgendermaßen zusammenfasst: »[I]m Prinzip kann man sagen, der Person werden verschiedene Taten vorgeworfen, die [das Gericht] gemeinsam behandelt und in einem Urteil ab[ ]urteilt. Und für diese Taten bekommt die Person eine Strafe, ausgerichtet am Strengstmöglichen.« Für die Diagramme des PARRHESIA-Projekts, deren Analyseprozess sich ohnehin noch dynamisch gestalte, wie Ulrike Möntmann einräumt, bedeutet dies eine Überprüfung der juristisch korrekten Zuordnung zwischen Strafregistereinträgen und Haftzeiten. Interessant bleibe aber ihrer Ansicht nach doch die Frage nach den eben nicht nur juristischen Konsequenzen einer Tat für die Person, die mithilfe der Diagramme visuell erfahrbar sein sollen.
V. Biografien
Vor der Präsentation einer der im Rahmen des Projekts erarbeiteten Biografien nimmt die thematische Vielfalt der Diskussion noch einmal deutlich an Fahrt auf. Zunächst wird die dafür von Ulrike Möntmann entwickelte Matrix-Methode erörtert, die in TBDWBAJ bereits wirksam zum Einsatz kam. Aus einem Katalog vorgedruckter Wörter können die Frauen jene auswählen, die sich für ihre jeweilige Lebensgeschichte eignen; »es sind Begriffe«, erklärt Möntmann, »von denen ich glaube, dass man damit ungefähr jede Lebensgeschichte erzählen könnte«. Aber natürlich gebe es, wie sie auf Veronika Hofingers Nachfrage hin konkretisiert, zielgruppenspezifische Unterschiede, etwa bei dem Wort ›Liebe‹, dass bei den drogenabhängigen Frauen selten, zumeist nur im Zusammenhang mit Kindern vorkomme.
Möntmann beschäftigt jedoch noch einmal die Frage nach der Unverhältnismäßigkeit der Taten und Strafen von Rebecca Mertens. »Strafhaft per se« sei nicht sinnvoll, meint auch Monika Stempowski, das sei auch Konsens in der Kriminologie: »Die Haft an sich, wenn man sonst nicht tut, schadet.« Positive Effekte würden allenfalls durch Therapie- und Fortbildungsangebote erreicht sowie durch ein gezieltes »Übergangsmanagement« in die Freiheit im Rahmen eines strukturierten »Resozialisierungsprozesses«. Aber der entscheidende Punkt liege viel früher, betont sie weiterhin, nämlich »bei der grundsätzlichen Kriminalisierung der Personen, die die Substanzen erwerben und konsumieren«. Diese viel diskutierte Frage nach Legalisierung werde in verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich gehandhabt und bedürfe insgesamt einer abgestimmten Regelung, etwa mit den Vereinten Nationen. Einig sei man sich aber im Hinblick auf die schädliche Kriminalisierung: »Das allein bringt uns gar nicht weiter.«
Die Gesprächsrunde wird nun um Barbara Kraml erweitert; die Juristin und Politologin hat sich in ihrer Dissertation im Anschluss an Foucault und Butler theoretisch mit dem Verhältnis von Norm und Normalisierung befasst, was Ulrike Möntmann zum Anlass nimmt, noch einmal auf den eingangs bereits diskutierten »Stolperstein Sprache« zurückzukommen, schließlich sei das erklärte Ziel des Kompliz:innentreffens, »dass wir einander verstehen können im Sinne eines interdisziplinären Verständnisses«. Das aber hieße eben auch Übersetzungsarbeit juristischer Fachterminologie in Alltagssprache. Auch Monika Stempowski sieht hier Bedarf, markiere doch gerade die Suchtmittelthematik einen »Überschneidungsbereich« zwischen juristischen und psychiatrischen Problemen. Wie schwierig Strafregister zu verstehen seien, hat Stefanie Elias im Rahmen des PARRHESIA-Projekts selbst erfahren. Was wissen die betroffenen Frauen über diese kompliziert verfassten Schriftstücke? Zwar sei ihnen Akteneinsicht zu gewähren, es bleibe aber fraglich, inwiefern sie dies de facto in Anspruch nehmen, oder vielmehr: von ihren Strafverteidiger:innen tatsächlich ermuntert werden, sich damit ganz konkret auseinanderzusetzen, meint Barbara Kraml.
Daran anschließend berichtet Ulrike Möntmann von einer Frau, der ersten Sinti, die an einem ihrer Projekte teilgenommen hat, die im Rahmen der Speech Activities die Paragrafen, die in ihrem Strafregister zur Anwendung kamen, eingelesen hat; zunächst mühevoll und »holprig«, dann immer »runder«. Und dennoch merke man der Audioaufnahme an, wie fern ihr dieser juristische Duktus sei, dessen Sinn sie kaum wirklich erfassen könne. Lediglich sich wiederholende Formulierungen führten punktuell zu einem kurzen »Aha-Effekt«, vor allem aber zum Staunen darüber, dass es bei diesen »schwierigen Formulierungen […] um ihr Leben ging«.
Als Nächstes wird die Biografie Ivana Landmanns gehört und gelesen. Ulrike Möntmann ist ihr über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren mehrfach begegnet, immer wieder mit Hoffnungsschimmern, etwa durch eine begonnene Therapie, immer wieder mit dem Eingeständnis, dass sie von den Suchtmitteln nicht wegkommt. »Wenn ich daran denke, dass sie demnächst oder in ein paar Jahren entlassen wird – es fehlt mir einfach die Vorstellungskraft […], wo und vor allem auch wie sie innerhalb der Gesellschaft eigentlich noch einen Platz finden kann.« Ivana Landmann ist durch die extremen Gewalt- und Missbrauchserfahrungen, durch lange Haftzeiten und die aus all dem resultierenden Drogensucht psychisch wie physisch ein zutiefst beschädigter Mensch ohne Kraft, Halt und Orientierung. Zu Möntmanns völligem Unverständnis werde aber mit ihr wie mit einer ganz ›normalen‹, gesunden Gefangenen umgegangen, die sich nach dem Absitzen ihrer Haftstrafen in eine Gemeinschaft zurückbegeben soll. Unter anderen Umständen würde eine Frau mit Ivanas Konstitution als Schwerstinvalidin eingestuft. Bei Invalidität durch Drogensucht aber scheint den Betroffenen die »Selbstverschuldung der Misere« angelastet zu werden – was wieder zu der Frage führt: Wer ist verantwortlich für all die ›Kollateralschäden‹ sexueller Gewalt im frühkindlichen Alter? Genauer: Wer sorgt – ganz praktisch gesehen – für die Opfer?
VI. Drogenkonsum
»Mein Gefühl ist schon, dass das von klein auf eine Selbstmedikation ist, aufgrund dieser massiven Gewalterfahrung, die sie erlebt hat, und der Folgeerkrankungen, die sich entwickelt haben«, vermutet Johanna Meyer. Zu fragen wäre also, was man im Hinblick auf eine mögliche alternative Medikation und auch im Hinblick auf eine sie stabilisierende Ausbildung während der Inhaftierungen und weiteren Maßnahmen für Ivana Landmann getan hat. Veronika Hofingers Eindruck nach werde das Drogenthema in vielen Gefängnissen einerseits ignoriert, andererseits stigmatisiert, was Ulrike Möntmann und Stefanie Elias bestätigen: Zwar sei das Wachpersonal zumeist durchaus im Bilde über Drogen- oder Medikamentenaustausch beispielsweise bei Freigängen im Hof, und dieser werde prinzipiell auch sanktioniert, häufig jedoch auch ganz einfach geduldet. Das sei eine »Vollzugsrealität«, stellt Monika Stempowski fest, mit »den Gegebenheiten, Grenzen, die dieses System aufzeigt. Und die Grenzen sind enorm für alle Beteiligten. Also auch die Bediensteten haben nicht die Ressourcen und die Möglichkeiten oder die Kompetenzen, um auf all diese Dinge zu reagieren […].« Ulrike Möntmann begegnete sogar einem Anstaltsleiter mit folgender Devise: »[M]an muss immer dafür sorgen, dass nicht zu viel und nicht zu wenig Drogen im Knast sind«. Und beim Gefängnispersonal herrsche Möntmanns Erfahrung nach überwiegend eine ambivalente Haltung zwischen »Selbst-schuld«-Mentalität und der Einsicht, dass man Personen wie Ivana Landmann eigentlich mittels einer kontrollierten Medikation helfen müsste, also »gratis Heroin sauber und ordentlich täglich verabreichen und hoffen, dass [die Person] in irgendeiner Form nicht kaputtgeht« an den Folgen der erfahrenen Grausamkeiten. Konzeptlosigkeit bei allen Beteiligten sei das Problem, meint auch Johanna Meyer, schwerwiegend insbesondere für die freikommenden Häftlinge. »Ich würde sagen, sie kann nicht mehr freikommen«, konstatiert Ulrike Möntmann bitter, zumal sich weder ihre Eltern noch sonst irgendjemand draußen um sie kümmern werde.
Abgesehen von im Gefängnis eingeschliffenen Verhaltensweisen sei zudem die Welt da draußen nach langen Haftstrafen eine andere – Stichwort Digitalisierung –, ergänzt Monika Stempowski. Im Grunde müsse man nach der Entlassung »etwas Vergleichbares finden wie Gefängnis«, pflichtet ihr Ulrike Möntmann bei, denn Ivana Landmann stecke in einer fatalen Sackgasse: Im Gefängnis hält sie es kaum noch aus, mit der Freiheit draußen umzugehen, wird aber mindestens ebenso schwierig. Wichtig sei daher die mancherorts bereits begonnene Etablierung eines auf Dauer gestellten Maßnahmevollzugs für psychisch kranke Menschen, der jährlich evaluiert wird und nur unter der Bedingung in Freiheit entlässt, dass es ein Auffangnetz gibt. »Das heißt, es gibt eine Form von Kontrolle, es gibt in der Regel psychiatrische Überwachung, also Behandlung und Überwachung usw.« Das sei aus einer »rein strafrechtlichen Perspektive sehr erfolgreich […], weil die Rückkehrraten sehr niedrig sind. Also diese Form von über den unmittelbaren Vollzug hinausgehende Versorgung, Begleitung und Kontrolle ist jetzt rein, wenn man darauf abzielt, dass Personen nicht wieder straffällig werden, sehr effizient.« Unter anderem darin unterscheide sich der Maßnahmevollzug vom Strafvollzug: »Wenn jemand seine Strafe abgesessen hat, dann enden hier meine Möglichkeiten in aller Regel.« Alle begleitenden Angebote seien dann eben nur noch freiwillig. In diesem Zusammenhang erzählt Ulrike Möntmann von einer älteren straffälligen Frau mit jahrzehntelanger Drogensucht, die von keiner Therapieeinrichtung mehr akzeptiert wurde. Schließlich wurde sie dann in einem LÜSA aufgenommen, einem Langzeit Übergangs- und Stützungs-Angebot, das es nur in Deutschland gibt: Darin dürfen die Bewohner:innen, die als austherapiert gelten, unter Beachtung der Hausordnung Drogen »gebrauchen, und sie dürfen auch substituiert sein, was ja in ganz vielen anderen Einrichtungen nicht der Fall ist.« Ihre Aufnahme dort habe sie dann dennoch missmutig mit den Worten kommentiert: »Wer will schon gerne ein hoffnungsloser Fall sein?«
VII. Ein Labyrinth voller Sackgassen
Johanna Meyer kommt nun auf die vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten in Österreich zu sprechen, räumt aber zugleich ein, dass auch hier oftmals fehlende Kommunikation und stockender Informationsfluss zwischen den beteiligten Stellen, Institutionen und Personen das Problem seien. Niemand fühle sich richtig verantwortlich, dem Recht auf Beratung auch mit tatsächlicher Förderungsbereitschaft nachzukommen, insbesondere im Fall von Süchtigen und/oder Jugendlichen, denen es häufig (noch) an kognitivem Vermögen fehle. Ob es Männer nach der Entlassung einfacher hätten, sich zu integrieren, will Stefan Auberg mit Blick auf grundlegende Genderaspekte wissen. Dazu fehle es nach Veronika Hofingers Einschätzung an Daten, insgesamt aber sei die Rückfallrate bei Männern durchschnittlich höher, außerdem werde hier vermutlich genderunspezifisch eher nach Erfolgsaussichten denn nach Bedürftigkeit in entsprechende ›Fälle‹ investiert.
Ivana Landmann sei eigentlich lammfromm, ohne jede genuin kriminelle Energie, meint Ulrike Möntmann. Durch das Stehlen eines Rezeptblocks konnte sie sich jahrelang selbst mit Drogen versorgen. In der Haft aber kommt plötzlich der Vorwurf der Körperverletzung ihrerseits hinzu, die sie als solche erst gar nicht wahrgenommen habe; Gewalt untereinander, zumal im Umfeld von Sucht und Drogenkonsum, sei im Gefängnis schließlich keine Seltenheit. Für das Strafmaß ist das jedoch ausschlaggebend, da es sich erhöhen kann. »Drogendelikte [haben] einen hochsignifikanten Einfluss […] auf schwere körperliche Gewalterfahrung in Haft«, bestätigt auch Veronika Hofinger anhand vorliegender Daten.
Ulrike Möntmann kommt nun auf Stefan Aubergs Frage nach Genderunterschieden zurück und erzählt, wie vor Jahren in den Niederlanden das »Veelpleger«-Gesetz eingeführt wurde, das den Staat berechtigt, Wiederholungstäter:innen präventiv für zwei Jahre zu inhaftieren. Dieses Programm sei ausschließlich auf Männer ausgerichtet, wurde aber auch auf Frauen angewendet, die weit weniger straffällig werden. Auf Nachfrage, wie das sein könne, hieß es seitens des seinerzeit zuständigen Innenministers, »weil Frauen ein zu vernachlässigendes Phänomen in der Strafhaft sind«, für die kein kostspieliges eigenes Programm entwickelt werden solle.
Stefanie Elias richtet sich nun mit der Frage, ob es Zahlen darüber gebe, dass Inhaftierung Drogenkonsum begünstigt, an Veronika Hofinger, was diese bejaht: Daher versuche man, Jugendliche so lange wie möglich aus dem Strafvollzug rauszuhalten und andere Maßnahmen wie Therapie statt Strafe zu ergreifen. Problem sei dann aber auch hier eine »chronische Unterfinanzierung« und »Personalmangel«, ergänzt Barbara Kraml gestützt auf ihre Wahrnehmungen im Vollzug der Justizanstalt Wien-Josefstadt, »das führt dann zu einem Setting, das Körperverletzungen untereinander begünstigt«. Einen Unterschied zwischen den Geschlechtern gebe es prinzipiell schon durch den Grundsatz des Strafvollzugsgesetzes, der eigentlich vorsieht, Jugendliche getrennt von Erwachsenen zu inhaftieren, im Rahmen eines »Jugendschutzes […] im weitesten Sinne«. Nun sei aber die Gruppe jugendlicher Mädchen, deren Delikte derart schwerwiegend sind, dass es zu Freiheitsstrafen kommt, extrem klein – was dazu führe, wie Ulrike Möntmann fortsetzt, dass diese Trennung aus Kapazitätsgründen häufig nicht berücksichtigt werde. Auch Barbara Kraml bestätigt diesen Missstand insbesondere in der Untersuchungshaft, und selbst in den großen österreichischen Gefängnissen würden allenfalls jugendliche und erwachsene Männer getrennt, Mädchen und Frauen hingegen nur höchst selten. Monika Stempowski macht diesbezüglich aber auch auf mögliche Nachteile aufmerksam, denn »würde man diese Trennung wirklich ganz strikt durchziehen von A bis Z, hätte das natürlich umgekehrt wieder die Konsequenz, dass die Gruppe, von denen es am wenigsten gibt, an ganz, ganz vielen Dingen wieder nicht partizipieren können«. Insgesamt, so ließe sich an diesem Punkt der Diskussion festhalten, seien die gesetzlichen Regelungen etwa zum Maßnahme- und Strafvollzug für psychisch kranke Menschen weitaus differenzierter und eröffneten theoretisch mehr Möglichkeiten, als es in der Realität aufgrund von allerorts mangelnden finanziellen, personellen und auch räumlichen Ressourcen tatsächlich der Fall sei.
Problematisch sei auch die Versorgung mit anderen Medikamenten wie Psychopharmaka und Benzodiazepinen, die teils offenbar zur Ruhigstellung der Häftlinge, teils zur Selbstmedikation, jedenfalls häufig missbräuchlich eingesetzt würden, was jedoch ein allgemeines suchttherapeutisches Thema ist, in dem den Gefängnispsychiater:innen eine schwierige Rolle zukommt.

RAP: ICH HAB MAL WIEDER STREIT MIT MIR SELBST von Esma Bronkovič
In der Regel hätten die Frauen Hemmungen, wie Stefanie Elias aus einem Gespräch mit Esma Bronkovič und anderen berichtet, den Psychiater:innen überhaupt etwas zu erzählen, da sie gewissermaßen mit dem Personal ›unter einer Decke steckten‹ und zu befürchten sei, dass das Anvertraute gegen sie verwendet würde. Im Grunde seien Psychiater:innen nach Ulrike Möntmanns Eindruck eher für die Medikation zuständig als für ein echtes Therapieangebot.
Im Zentrum von Esma Bronkovičs Raps steht eine massive »Schuldthematik«, meint Johanna Meyer, was Möntmann bestätigt und um die Begriffe »Mutter« und »Religion« ergänzt: »Es ist immer irgendein Deal mit dem Teufel«. Sie habe alles darangesetzt, »eine ganz schlechte Muslima« zu sein. Umso tragischer sei es, wie Johanna Meyer feststellt, dass sie keine Therapieangebote bekommen hat. Auch für Ivana Landmann hat Singen etwas Tröstendes, was auch in ihrer Biografie zum Ausdruck kommt.
VIII. Wer trägt die Konsequenzen?
Letzter Punkt der Diskussion ist Ulrike Möntmanns Anliegen, gemeinsam mit den Juristinnen und Psychologinnen das bestehende Sexualstrafrecht kritisch zu betrachten: Warum gibt es keinen öffentlichen Ankläger in Fällen sexueller Gewalt, warum ist das stets den Opfern überantwortet, die ja zumeist aus Angst, Scham- und Schuldgefühlen schweigen? Barbara Kraml meint, die Frage eröffne »ein ganzes Problemfeld […] mit einzelnen Bereichen«. Erstes Problem sei, dass sich sexueller Missbrauch häufig schon im Kindesalter im engsten Umfeld zutrage und hier nur wenige Institutionen Zugriff hätten. Zudem sei das Betreuungspersonal in Kindergarten, Schule und Freizeitstätten viel zu wenig geschult, um solche Anzeichen wahrzunehmen und etwas in die Wege zu leiten. Hinzu komme bei kleinen Kindern entwicklungspsychologisch bedingte Probleme der Glaubwürdigkeit, da sie zumeist eine ausgeprägte Fantasie, aber noch kein Zeitgefühl hätten, was ihre Erzählungen oftmals heikel machte. Wenn sich die Opfer dann später adäquat artikulieren könnten, sei es aufgrund der Verjährungsfrist häufig bereits zu spät für eine Anzeige, und sogar Anwält:innen rieten wegen der dünnen Beweislage von Anzeigen ab – um sich nicht »eine nächste Ohrfeige für das Opfer« einzuholen.
Ulrike Möntmann insistiert, dass aber ja genau für all das dringend Lösungen zu finden seien. Veronika Hofinger findet ebenfalls, dass das Strafmaß für Sexualstraftäter:innen etwa im Vergleich zu Vermögensdelikten häufig viel geringer ausfiele: Aus ihrer eigenen Erfahrung als Schöffin weiß sie, dass etwa ein Raubüberfall mit einer Spielzeugpistole oder auch der Anbau von großen Mengen an Marihuana zu einem jeweils höheren Strafmaß geführt haben als Sexualdelikte. Die Frage wäre also, ob ein prinzipiell höheres Strafmaß für Sexualstraftäter:innen eine Lösung ist, was Barbara Kraml verneint, im Gegenteil: Erfahrungsgemäß würde die Anzeigenbereitschaft bei den Opfern sogar sinken – insbesondere wenn es um Familienmitglieder geht –, in dem Wissen, dass die Täter:innen dann gleich mehrere Jahre ins Gefängnis gehen. Wichtiger sei es daher, das Bewusstsein bei allen externen Instanzen zu fördern, also »hinzuschauen, wenn es denn den Verdacht gibt, dass da etwas sein könnte, und was muss ich denn dann dokumentieren, und wie gehe ich damit um«. Das gelte im Übrigen auch für das medizinische Personal, ergänzt Veronika Hofinger, das geschult darin sein sollte, bei Untersuchungen von Opfern klar zu erkennen und entsprechend zu dokumentieren, dass es sich um sexualisierte Gewalt handelt.
Monika Stempowski akzentuiert in diesem Zusammenhang noch einmal die Problematik der Beweislage für das Gericht, die im Sexualstrafrecht weitaus komplizierter sei als in anderen Deliktsbereichen: Selbst bei guter medizinischer Dokumentation gebe es »in aller Regel nichts […] für den Strafprozess, außer [der] Aussage der betroffenen Person. Wenn die nicht anzeigt, wenn die nicht aussagt, kann niemand irgendetwas tun. Und selbst wenn sie aussagt, ist es eben anders als überall sonst, es ist in der Regel natürlich niemand dabei, es gibt keine Sachbeweise in irgendeiner Form, das heißt, das Einzige, was das Gericht tun kann, ist, die beiden Personen, um die es geht, [zu] vernehmen. Und da greift natürlich der Grundsatz, dass das Gericht so überzeugt sein muss von der Schuld, damit es verurteilt, und wenn es Zweifel hat, darf es eben nicht verurteilen […].«
Ulrike Möntmann kommt nochmal auf ihren Ausgangspunkt zurück: »[E]s geht mir jetzt nicht darum […]: mehr Strafe, dann wird alles gut. Nein, es geht aber wohl um eine große Frustration über Nichtreaktion auf ein lebenszerstörendes Ereignis.« Die Gewalt werde offenbar einfach »gebilligt«. Würde man aber die Opfer, die Frauen, ernst nehmen, ihnen Hilfe und Unterstützung anbieten, wäre schon viel gewonnen. Dieses »Nullinteresse«, schließt Möntmann, sei das Schlimmste daran. Barbara Kraml entgegnet, dass es ihres Wissens nach zumindest in Wien durchaus spezialisierte staatsanwaltliche Gruppen gebe, die sich mit Delikten im »sozialen Nahraum« befassen, mit gezielter Beweissicherung und speziell geschultem medizinischem Personal, und dass auch die Verjährungsproblematik inzwischen durch neue Bestimmungen verbessert worden sei.
Oft genug hat Ulrike Möntmann in ihren Projekten erlebt, dass sich Frauen ihre Erlebnisse sexueller Gewalt, ob als Kind oder später, selbst anlasten. Es gebe Studien, die besagen, dass es einen Zusammenhang zwischen frühkindlicher sexueller Gewalterfahrung und späterer Prostitution gebe, bestätigt Johanna Meyer, während Monika Stempowski in diesem Punkt erneut zur Vorsicht rät, da es insgesamt noch zu wenig Erkenntnisse über solche Kausalbeziehungen gebe, was auch aus den hier vorgestellten Biografien der Frauen deutlich hervorgehe, die ja zumeist »Multiproblemsituationen« beschrieben, mit wiederkehrenden Belastungen von frühester Kindheit an bis ins Erwachsenenleben. Gerade bei drogensüchtigen Frauen sei Prostitution ja häufig notgedrungen ein Weg, »Mittel zur Beschaffung zu generieren, um die Sucht zu finanzieren«. Laut Johanna Meyer gibt es immerhin Präventionsprogramme, in denen Kinder und Jugendliche angeleitet werden »schon früher auf ihre Grenzen zu achten, dass sie dann leichter so etwas zur Anzeige bringen«, und sich überdies frühzeitig lernen, grenzüberschreitenden Erfahrungen auch artikulieren zu können. Der Punkt seien ihrer Auffassung nach aber die »Abhängigkeitsverhältnisse«, die dazu führten, dass gerade Kinder und Jugendliche lieber schweigen oder vertuschen und sich isolieren, weil sie eine völlige Zerrüttung der Familie befürchten, die sie sich dann aufgrund ihres noch »egozentrischen Weltbilds«, wie Barbara Kraml ausführt, selbst anlasten. »Und das ist für Kinder ein Wahnsinn […]., ein nicht auflösbarer Loyalitätskonflikt, in dem man sie nur bestmöglich unterstützen kann. Aber auflösen kann man das in Wahrheit am Ende des Tages nicht.« Auch »die Mütter […] oder die jeweils andere Person« müsse viel mehr unterstützt werden, fordert Johanna Meyer. Neben der Schulung von Kindergärtner:innen, Lehrer:innen, medizinischem Personal etc. müsse man auch gesamtgesellschaftlich stärker aufeinander achten, fügt sie hinzu.
In einem Teufelskreis aus Gewalt und Vernachlässigung befand sich auch Rebecca Mertens, wie Ulrike Möntmann nun erzählt. Als Kind ist sie von ihrer Mutter massiv geschlagen worden, die wiederum von der Großmutter, wie Rebecca vermutete, ebenfalls geschlagen wurde. Jahre später sitzt die Enkelin im selben Gefängnis, in dem ihre Großmutter bereits inhaftiert war – umso wichtiger erscheint es Möntmann, dass Frauen wie Rebecca Anlaufstellen finden, wo man sie ernst nimmt. Im Kleinen sei ein solcher Effekt bereits in den zweiwöchigen Projektdurchführungen in den beiden Haftanstalten spürbar waren, fügt Stefanie Elias hinzu: »Allein dass da von außen zwei Frauen kommen und sich mal die Biografie anhören.« Viele der Frauen hätten gesagt, »ich habe diese Geschichte noch nie erzählt, das hat auch irgendwie niemanden interessiert«.
IX. Wie geht es weiter?
Für viele der am PARRHESIA-Projekt teilnehmenden Frauen sei es die erste selbstgewählte Arbeit, die sie zudem mit großem Enthusiasmus angegangen seien, erzählt Ulrike Möntmann. Es seien eben nicht nur »faule, arbeitsscheue Menschen«, wie viele innerhalb wie außerhalb des Gefängnisses glaubten. »Doch, die wollen sehr gerne arbeiten, aber wohl irgendwas mit Bezug zu sich selber, wie wir alle.« Dieses Abstempeln sieht auch Barbara Kraml als tiefsitzendes Problem an: »Ich glaube, dass […] diese zugrunde liegenden Verletzungen, die den Frauen passiert sind, im Strafvollzug so wenig Beachtung finden, liegt wahrscheinlich daran, dass der Fokus nur auf ihrem isolierten Verhalten, das strafrechtlich sanktioniert ist, liegt, und alles andere rundherum wegbleibt.« So bleibe völlig außen vor, »dass sie selber Opfer möglicherweise geworden sind und dass das möglicherweise auch ein Grund ist, warum sie überhaupt begonnen haben, Drogen zu nehmen«. Die Gründe für die Sucht interessierten das Gericht zumeist nicht, auch therapeutisch würde häufig nicht sehr tief eingestiegen. Stefanie Elias vermutet, dass der gesamte Apparat dafür schlicht nicht gemacht sei. Und Veronika Hofinger resümiert mit Blick auf PARRHESIA: »Das zeigt einfach, welchen kleinen Ausschnitt die Justiz eigentlich bearbeitet, das zeigt euer Projekt schon sehr gut.«
Ulrike Möntmann fordert die Teilnehmer:innen abschließend auf, ihre Einschätzungen zum bisherigen Projektverlauf mitzuteilen. Veronika Hofinger findet das Projekt spannend und durch die Diagramme sehr anschaulich. Sie findet es auch wichtig, dass die Teilnehmerinnen ihre Biografien erzählen und dadurch Verständnis geschaffen wird, für das, was den Frauen widerfahren ist. Besonders neugierig ist sie auf die Präsentation des gesamten Projekts, bei der es darauf ankomme, klarzumachen, dass hier »ein ganz bestimmter, enger, Ausschnitt betrachtet, sanktioniert, bestraft und damit eine gewisse Ordnung hergestellt« [werde], »die aber mit dem, was wirklich den Menschen angetan wird, sehr wenig zu tun hat«. Daran ist auch Möntmann gelegen, wie sie in den Einführungen zu den jeweiligen Projektdurchläufen immer betont: »[W]ir brauchen einander, um das möglich zu machen, die Projektarbeit, diese Forschung, sodass die Problematik, dass die Ereignisse wieder eine öffentliche Angelegenheit werden.« Statt Informationen zu bunkern, sollen die Frauen »diesen parrhesiastischen Mut haben, um aufzustehen und auszusprechen, was ihnen geschehen ist«. Deshalb initiiert sie die Ausstellung, die Website zum Projekt und die geplante begleitende Publikation – »um das in die Welt zu bringen«.
Johanna Meyer beschäftigt zum einen die Frage, wie es mit dem Projekt in Richtung Öffentlichkeit weitergeht. »Wie kann dieser Transfer gut gelingen? Dass dann vielleicht auch wirklich Veränderungen angeregt werden? Wie kann es bei den richtigen Menschen landen?« Und zum anderen interessiert sie die Meinung der beteiligten Frauen, also was die Projektarbeit und die Präsentation mit ihnen macht. Wurden sie so weit einbezogen, Wünsche oder weiterführende Ideen zu den erarbeiteten Materialien zu äußern? Stefanie Elias und Ulrike Möntmann erläutern, dass es in den beteiligten Institutionen, bislang also der JA Schwarzau und dem Schweizer Haus Hadersdorf, zum Abschluss zunächst immer eine interne Präsentation vor dem Personal und den Mithäftlingen gab, an denen die Frauen freiwillig teilnehmen konnten und dies in den allermeisten Fällen auch mit ebenso großer Aufregung und Angst vor möglichen negativen Reaktionen ebenso wie mit Begeisterung und Stolz taten, wenn sie schließlich Zuspruch und Bestätigung der anderen erfuhren, denen Ähnliches passiert ist, was sie aber zuvor nie untereinander preisgegeben hatten. In diesem Moment fühlten sie sich gesehen.
Johanna Meyer stärkt noch einmal den Punkt der »gesamtgesellschaftliche[n] Verantwortung«, »dieses wieder-damit-in-Berührung-Kommen«. Die massive Gewalterfahrung, die in den Biografien zum Ausdruck kommt, wird für die meisten Menschen weit weg sein, vermutet sie; zugleich würde aber deutlich, dass es sich hier um ›ganz normale‹ Menschen handelt, die auch nur versucht haben, sich ein Leben aufzubauen. Diese Überlegung findet sich auch in den digitalen Landkarten mit den jeweiligen Orten zu den Biografen auf der Website zum Projekt wieder, wodurch, wie Stefan Auberg erläutert, ein geografischer, vor allem aber emotionaler Bezug hergestellt werde. Zudem arbeitet Ulrike Möntmann an einem Soundspace, in dem man die Biografien und Speech Activities erleben kann.
Stefan Auberg verweist noch auf einen weiteren Punkt der Rezeption, nämlich den der Kunsterfahrung, die hier ja klarerweise auch eine wichtige Rolle spiele, da »das eine sehr schwere Thematik« sei; »also sich mit dem auseinandersetzen zu wollen, fordert schon mal viel Eigeninitiative und Eigeninteresse. Und wie Kunst oft erlebt wird, ist es eine ästhetische Motivation oder eventuell ein leichter historischer Bildungsauftrag, aber diese sehr spezielle Thematik einzuflechten in eine öffentlich zugängliche Ausstellung, hat sehr viele Fallpunkte oder sehr viele Komplikationen, damit man Leute überhaupt dorthin bekommt.«
Stefanie Elias sieht überdies schon die Beschwerden auf sie zukommen, dass es nicht »kindgerecht« sei, weshalb sie im Team bereits über Trigger Warnings, etwa auch für die Projekt-Website, nachgedacht hätten. Johanna Meyer regt dazu an, »Verlinkungen zu Hilfsangeboten« zu setzen. Ulrike Möntmann stellt jedoch klar: »Eher nicht. Damit verlasse ich mein Gebiet von Kunst und Wissenschaft, ich möchte unbedingt zurückhaltend bleiben«, also nicht behaupten zu wissen, was zu tun sei, oder jemanden mit erhobenem Zeigefinger überreden, sich damit zu befassen.
Auf Veronika Hofingers Frage nach Prozentzahlen von Frauen mit Drogenproblemen im Gefängnis erwidert Ulrike Möntmann, dass es erfahrungsgemäß zumeist gut sechzig Prozent und mehr seien, die aber zumeist durch die Statistik fielen, weil sie ja in der Regel wegen Diebstahls und ähnlichen Delikten und nicht wegen Drogenkonsums inhaftiert werden. Eine wichtige Information, meint Hofinger, denn es geht hier demnach nicht um Einzelfälle. Es sei »definitiv kein Nischenproblem«, konstatiert auch Stefanie Elias, »sondern es ist ein Thema, das den Alltag im Gefängnis bestimmt«. Leider würden die Zahlen, wie Monika Stempowski anmerkt, in Österreich – anders als in manchen anderen Ländern – nicht systematisch erhoben. Auch sie begrüßt das PARRHESIA-Projekt insgesamt sehr, insbesondere die erarbeiteten Biografien, durch die ein sehr anschauliches Narrativ entstehe. Sie schärft aber nochmal ihren Hinweis auf erforderliche Korrekturen bei der Darstellung in den Diagrammen von Lebensereignisse in Verknüpfung mit Drogenkonsum und strafrechtlichen Konsequenzen; vielleicht sogar entlang der sexuellen Übergriffe, die den Frauen fast allen gemein sind. Diese Idee unterstützt auch Barbara Kraml, weil es »die typischen Muster, typische Verläufe einfach noch einmal sichtbarer macht«. Darin könnte aber auch die Gefahr liegen, dass Frauen, die aus diesem Muster herausfallen und dennoch drogenabhängig und straffällig sind, umso mehr »verteufelt« würden, gibt Stefan Auberg zu bedenken. Zumal, wie Barbara Kraml hinzufügt, nicht der Anschein erweckt werden solle, dass es sich um eine vermeintlich quantitative Auswertung handele, die dann aber doch ›nur‹ dreißig Biografien enthält und somit nicht repräsentativ bzw. aussagekräftig sei. Ulrike Möntmanns Fazit daraus ist, dass die Fokussierung unterschiedlicher Aspekte der gesammelten Daten immer neue Perspektiven und Interpretationen hervorbringt, was sie auch immer wieder erstaune – und die Aufgabe der Kunst sei es nun, all dies auf eine Weise sichtbar zu machen, »dass es aufgenommen wird«.
Barbara Kraml stellt noch einmal den »wertschätzenden Umgang auf Augenhöhe« heraus, den sie schon dem Vorgängerprojekt TBDWBAJ bzw. der dazugehörigen Publikation entnommen habe, »auch in der Aufbereitung der Ergebnisse« und in der beständigen Kommunikation mit den beteiligten Frauen lange nach Projektende, die eben nicht plötzlich wieder verschwinden »sozusagen als untersuchte Objekte, sondern die bleiben präsent, und das finde ich wirklich schön«. Ulrike Möntmann unterstreicht daraufhin nochmal die gebotene Zurückhaltung, die ihr selbst in all den Jahren manchmal schwerfiel, als »ich mich plötzlich dabei erwischte, dass ich die Frauen erzählte«, was einer Interpretation gleichkomme, die sie unbedingt vermeiden wolle – die Frauen sollen für sich selbst sprechen. Dass wir aufeinander angewiesen sind, um gesellschaftliche Situationen und Positionen zu problematisieren, schließt Möntmann, sei nicht nur ein fairer Deal, sondern auch eine schöne (die ideale) Art der Begegnung.
Transkript: Stefanie Elias
Zusammenfassung: Gesa Steinbrink
TEILNEHMERINNEN:
- Veronika Hofinger (VH), Stellvertretende Leiterin des Instituts für Angewandte Rechts- und Kriminalsoziologie, Universität Innsbruck, Österreich
- Barbara Kraml (BK), Juristin und Politologin, Wien, Österreich
- Johanna Meyer (JM), Jugendcoachin, Klinische- und Gesundheitspsychologin, Wien, Österreich
- Ulrike Möntmann (UM), Künstlerin und Arts-based Researcherin, Projektleitung, Amsterdam und Wien, Niederlande und Österreich
- Monika Stempkowski (MS), Juristin, Klinische- und Gesundheitspsychologin, Mediatorin, Wien, Österreich
- Stefan Auberg (StA), Design und Projektmanagement, Amsterdam, Niederlande
- Stefanie Elias (StE), Schauspielerin und Regisseurin, Wien, Österreich